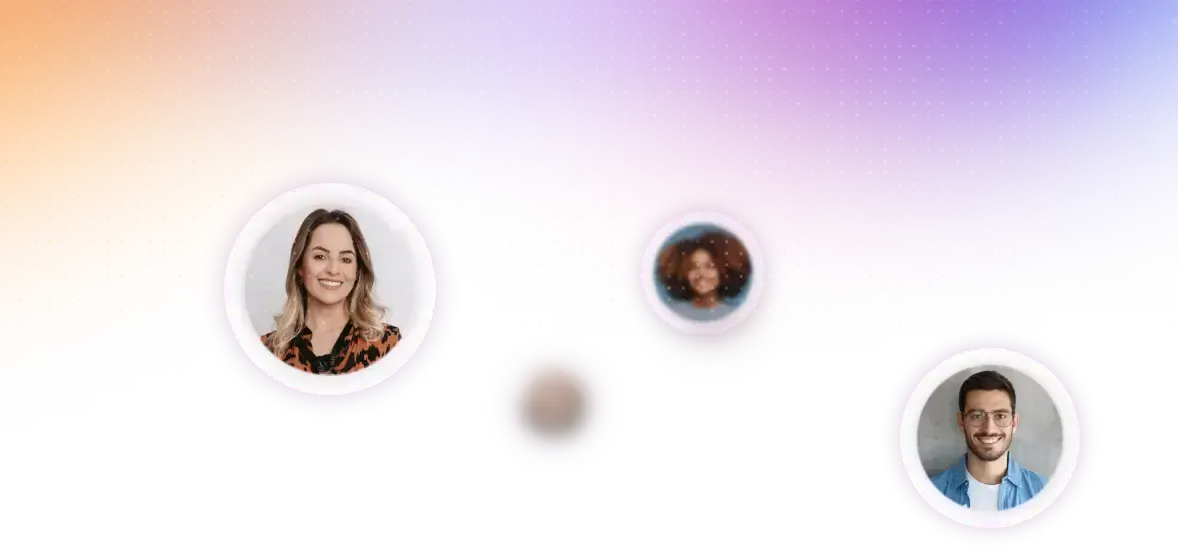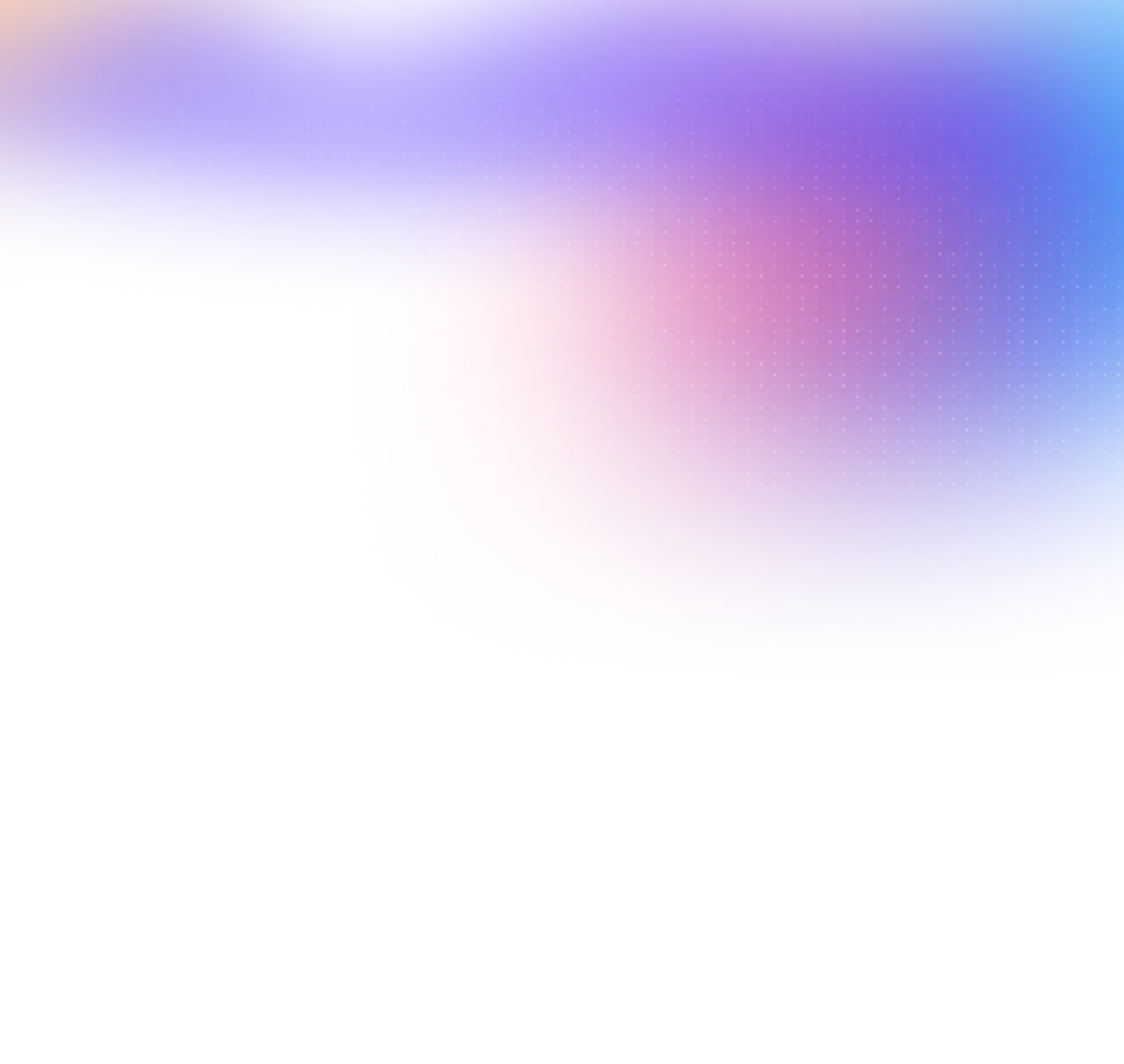

Aber wir haben seit etwa 2015 probiert, das zu öffnen. Wir haben damals gemerkt, dass insbesondere Frauen Probleme mit der Armee hatten. Genauer: Mütter. Denn sie müssen ihre Söhne abgeben in einen Block, wo sie keinen Zugang, keine Ahnung und überhaupt kein Verständnis haben. Das haben wir versucht zu öffnen.
Aber weil die Armee ein so grosses System ist, lässt sie auch immer wieder andere zu. Unser aktueller Chef der Armee hat so einen Spruch: «Es gibt die Red Monkeys und es gibt die Farmers.» Ich weiss nicht, ob Sie dieses Bild kennen.

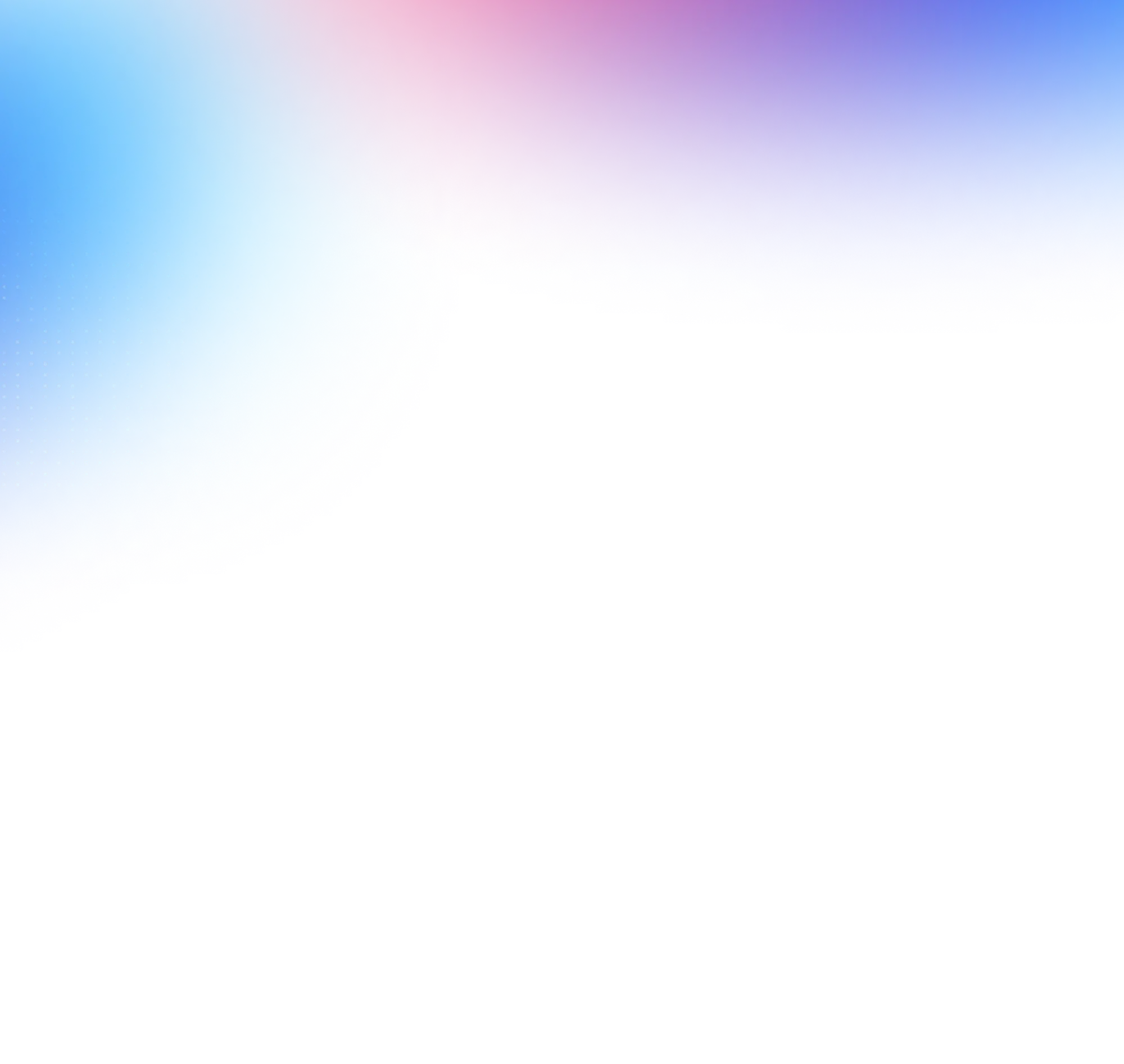
Es ist zweischneidig. Wer etwa in Merkel eine «Friedenskanzlerin» sieht, zeigt eine etwas eurozentristische Sichtweise. Sie war eine Vertreterin der Idee «Kooperation durch Verschränkung des Handels». Aber weltweit gab es immer zwischen 30 bis 50 offene Konflikte.
Jetzt ist die Bedrohung direkter, näher. Meine drei grossen Sorgen sind erstens eine Weltwirtschaftskrise. Zweitens diese Kultur des Bullying, also das Recht des Stärkeren. Die Art und Weise, wie man mit supranationalen Organisationen umgeht, lässt ja wieder zu, dass man Länder erobert. Das Dritte ist dieser Kulturkampf, der sich jetzt entwickelt hat, insbesondere in Amerika. Aber vor allem auch bei uns etwas näher: Ungarn und Slowakei – Polen wird folgen. Da sind wir in Auseinandersetzungen und Fragestellungen drin, die wir uns vorher nicht hätten vorstellen können.
Welche meinen Sie konkret?Ungarn ist recht klar. Ungarn war ja auch ein Vorbild für das Project 2025 von der Heritage Fundation und Trump. Deren Zielfrage ist: «Wie kann man mit den demokratischen Mitteln einen demokratischen Staat aushebeln und in autoritäre Züge verwandeln.» Erkenntnis: Man muss zuerst alle Autoritäten abschaffen, respektive kaputt schiessen. Dann kommen die Medien dran, dann die Justiz, dann muss man die Bildung gleichschalten. Das ist ja ein bisschen das, was in Ungarn geschehen ist. Das ist das, was etwas Sorge bereitet.
Wir sind jetzt unmittelbar betroffen.
Was sind die Konsequenzen?Das kann sofort weitreichende Folgen haben: Unsicherheit, Unruhen. Eigentlich bin ich zwanzig Jahre genau für eine solche Situation ausgebildet worden. Also ich fühle mich pudelwohl, denn das ist ja genau das, was wir immer vorgedacht haben – und immer gehofft haben, dass es nicht eintritt. Ich wäre froh, es wäre nicht so.Das ist ein bisschen, wie wenn man am Morgen aufwacht und sagt: «Wenn ich keine Schmerzen mehr habe, bin ich tot.» Sobald ich also mal keine Widerstände mehr spüren würde, hätte ich das Gefühl, ich würde falsche Dinge machen.
Für mich sind Widerstände immer ein Zeichen, dass wir Triggerpoints erreicht, jemanden aus seiner Komfortzone rausgeholt und dass wir Punkte haben, die sehr wahrscheinlich verfolgenswert sind. Und deswegen habe ich immer das Gefühl, ich wachse an Widerständen. Ich brauche die fast, auch um dann jeweils die Einordnung machen zu können. Man wird nie in der Lage sein, alle Widerstände vorwegnehmen zu können.
Habe ich etwas nicht gefragt, was Sie gerne gesagt hätten?Nein, für mich war es wirklich spannend. Hat mal wieder gutgetan. Wir leben in Blasen, stelle ich fest. Zurzeit ist es gerade in meinem Umfeld unglaublich spannend. Ich darf viele Dinge machen, die wirklich nichts mit diesem Militär zu tun haben.Zum Beispiel?Wir haben versucht, die Wirtschaft näher ans Militär zu bringen oder uns in die Wirtschaft zu bringen. Bildungsinstitutionen, von denen man immer gesagt hat, die werden nie mit der Armee kooperieren, machen jetzt Ausbildungen bei uns. Da hat sich schon etwas getan.